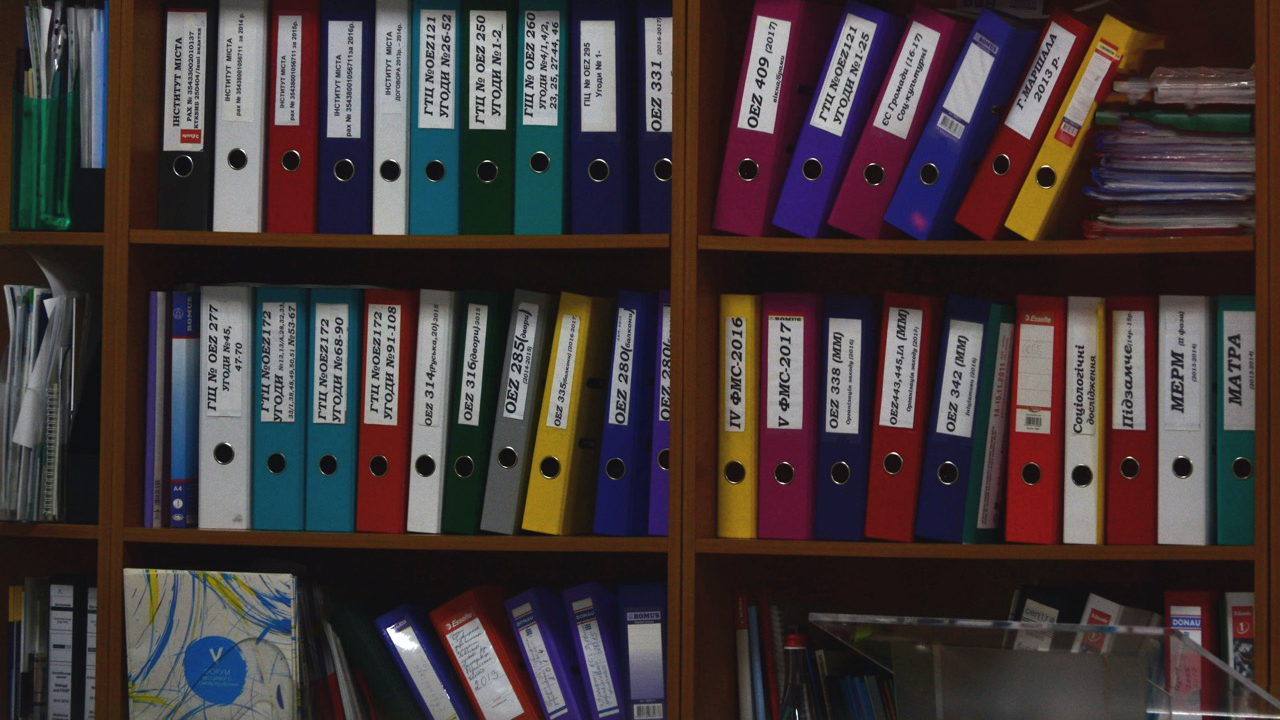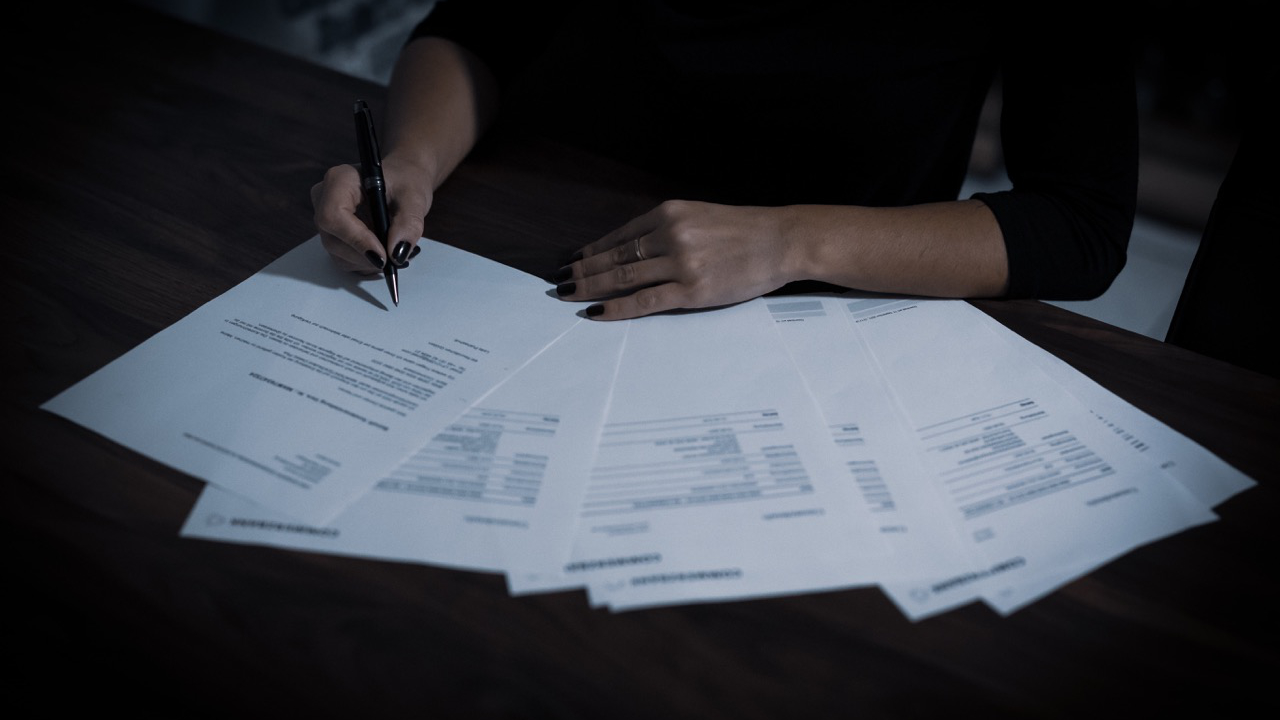Aktuelles
Ist ein Berliner Testament sinnvoll?
Das Berliner Testament erfreut sich größter Beliebtheit. Überall im Internet findet man Muster, wie man ein solches Testament erstellt. Es scheint den Bedürfnissen der meisten Leute zu entsprechen. Das scheint aber oft nur so, oft hat es Folgen, die man so gar nicht...
Behindertentestament nicht für Arbeitslose?
Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH (NJW 1990, 2055) darf ein Erblasser sein Testament so gestalten, daß ein behinderter Abkömmling, der auf Sozialleistungen angewiesen ist, nur das bekommt, was auf die Sozialleistungen nicht angerechnet wird. Damit kann dem...
Unsere Rechtsgebiete
Arbeitsrecht
Im Bereich des Arbeitsrechts vertreten wir sowohl die Interessen von Arbeitgebern als auch von Arbeitnehmern.
Arzthaftung
Beratung in allen Fragen des ärztlichen Heileingriffs, bei den Verfahren vor den Schlichtungsstellen und Durchsetzung von Patientenrechten.
Baurecht
Erstellung und Überprüfung von Bauverträgen aller Art. Beratung im Bauträger- und WEG-Recht, bei Architekten- und Ingenieurverträgen uvm.
IT-Recht
Beratung und Durchsetzung von Ansprüchen bei Mängeln von Soft- und Hardware-Verträgen, Vertragsabschlüssen über das Internet, im Domainrecht uvm.
Erbrecht
Wir vertreten die Interessen unserer Mandanten in allen erbrechtlichen Angelegenheiten außergerichtlich und gerichtlich, sowie vor Behörden, insbesondere Finanzbehörden.
Familienrecht
Wir vertreten unsere Mandanten in allen familienrechtlichen Punkten, wie z.B. Ehescheidungsverfahren, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen uvm.
Gesellschafts-recht
Wir beraten u.a. bei Erstellung und Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen, Umwandlung von Gesellschaften und Auseinandersetzung zwischen Gesellschaftern.
Handelsrecht
Wir bieten Beratung und Unterstützung bei Auseinandersetzung zwischen Handelsvertretern und Handelsgesellschaften, der Durchsetzung und Abwehr von Provisionsansprüchen uvm.
Markenrecht
Wir helfen bei der Anmeldung von nationalen Marken, Gemeinschaftsmarken und internationalen Marken, der Durchsetzung von Ansprüchen im Zusammenhang mit
markenrechtlichen Verstößen uvm.
Mietrecht
Im privaten und gewerblichen Bereich beraten wir bei der Begründung und Kündigung von Mietverhältnissen, Rückforderung von Mietkautionen, Mängeln an der Mietsache uvm.
öffentliches Recht
Wir vertreten die Interessen unserer Mandanten außergerichtlich und gerichtlich in allen Fragen des öffentlichen Rechts. Beispielsweise im öffentlichen Baurecht, Gewerberecht und Datenschutzrecht.
Ordnungsrecht
Beratung bei Ordnungswidrigkeiten aller Art, insbesondere bei
verkehrsrechtlichen Verstößen, bei Bußgeldverfahren vor den Behörden, sowie gerichtlichen Verfahren
vor den Amtsgerichten und Oberlandesgerichten.
Steuerrecht
Unsere Aufgabe ist Ihre steuerlich und rechtlich sachgerechte Vertretung in Rechtsbehelfsverfahren und Einspruchsverfahren vor den Finanzbehörden und Finanzgerichten.
Strafrecht
Wir begleiten und beraten unsere Mandanten in allen Stufen des Strafverfahrens von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens über die Hauptverhandlung bis hin zur Einlegung von Rechtsmitteln.
Urheberrecht
Beratung und Durchsetzung von Ansprüchen im Zusammenhang mit
urheberrechtlichen Verstößen, Erstellung von Abmahnungen und einstweiligen Verfügungen uvm.
Verkehrsrecht
Wir vertreten die Interessen unserer Mandanten in allen verkehrsrechtlichen Angelegenheiten gegenüber Unfallgegnern, Versicherungen und Behörden.
Versicherungs-recht
Beratung im Hinblick auf Versicherungsverträge aller Art. Beratung und Unterstützung von Versicherungen bei der Abwehr und Durchsetzung von Ansprüchen.
Vertragsrecht
Erstellung und Überprüfung von Verträgen aller Art, allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie Beratung und Unterstützung beim Aushandeln von Verträgen.
Vollstreckungs-recht
Unterstützung und Beratung von Gläubigern bei der Ermittlung von Schuldnerdaten, sowie der Durchführung und Abwehr von Vollstreckungsmaßnahmen.
Zivilrecht
Beratung und Durchsetzung von Ansprüchen im Zusammenhang mit
Kaufrecht, Werkvertragsrecht, Kaufrecht, Bankrecht, Reiserecht, Verbraucherschutz, Bürgschaftsrecht uvm.